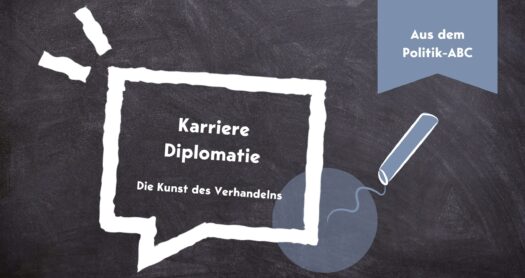Die Geschichte der Diplomatie geht zurück ins 15. Jahrhundert, der Zeit der alten Eidgenossenschaft. Damals hatte die «Diplomatie» wenig Achtung. Es wurden lediglich sogenannte Tagsatzungen gehalten. Das sind Sitzungen, in denen beispielsweise über Allianzen und Bündnisse verhandelt wurde. Gesandte aus dem Ausland residierten über längere Zeit in der Schweiz und nahmen an den Versammlungen teil. Die Schweiz hingegen schickte nur selten Vertreter ins Ausland.
1798 war das Zeitalter der Helvetischen Republik und damit einher ging die Gründung des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten. Nur wenige Tage später ernannte die Republik den ersten Diplomaten Peter Josef Zeltner. Zeltner wurde nach Paris gesandt. Dort war er als bevollmächtiger Minister tätig. Künftig fiel die Diplomatie in den Kompetenzbereich des Landammanns der Schweiz. Die Neutralität der Schweiz wurde von den Grossmächten anerkannt, führte aber dazu, dass die Tagsatzungen und Kantone keine selbständige Aussenpolitik verfolgen konnten. Vielmehr waren es Leute aus der Wirtschaft, welche die Schweiz im Ausland vertraten. Man sah vom Aufbau der Diplomatie ab, gerade weil es ein Kennzeichen des Acien Régimes war. Schon damals hatte es mit Misstrauen zu kämpfen.
Der nächste Meilenstein geschah 1848. Kurz nach der Gründung des Bundesstaats wurde das Eidgenössische Politische Departement ins Leben gerufen. Es wurde immer weiter ausgebaut, wenn auch aufgrund des Druckes von aussen. Berufsdiplomaten wurden als notwendig betrachtet. Denn nur so blieb die Schweiz vorne mit dabei und konnte das Weltgeschehen mitsteuern. 1896 erhielt das zuständige Departement den noch heute geltenden Namen «Eidgenössisches Departement des Auswärtigen (EDA)». Die Diplomatie wurde weiter ausgebaut, es gab sogenannte Minister und die Schweiz verhalf in politischen Spannungen zum Frieden. 1963 wurden alle «Gesandtschaften» in «Botschaften» umgewandelt. So gingen nicht mehr «Minister» ein und aus, sondern «Botschafter». Das System wurde insgesamt professioneller gestaltet.
Besonders der erste Weltkrieg war ein Treiber für den Aufbau von Botschaften. Nach dem ersten Weltkrieg wurde der Fokus auf den Wiederaufbau und die Neuordnung der weltpolitischen Lage gesetzt. Für die Staaten war es attraktiv, gute Handelsbeziehungen einzugehen und eine politische Stabilität zu schaffen. Der Beruf stand nicht mehr nur noch den Eliten zu. Ab 1955 mussten die Mitglieder des diplomatischen Dienstes einen Wettbewerb für die Zulassung auf sich nehmen. Fähigkeiten wurden trainiert und geprüft, um das Beste aus den Verhandlungen herauszuholen. Das Ziel schien klar: Politische Stabilität schaffen, auch um die Entwicklung weiterer Kriege in Zukunft zu vermeiden. Langsam aber sicher entwickelte sich die Diplomatie zu jener, die wir auch heute kennen.