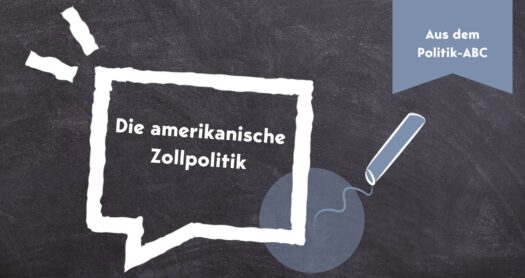Der Startschuss von Trumps grossflächigem Zollvorhaben kam am 2. April 2025. Zu einem Basiszollsatz von 10 % für alle Länder, erhob er zusätzlich für ausgewählte Staaten (Schweiz mit 31%) einen teils weitaus höheren. Begründet hat er sein Vorgehen damit, dass diese Länder die amerikanische Wirtschaft unfair schwer belasten (z. B. mehr in die USA einführen als von ihr zu beziehen) und die Zölle einen Ausgleich dazu schaffen sollen.
Seit diesem Tag hat sich wieder einiges verändert, trotzdem soll hier eine kleine Momentaufnahme zur Übersicht helfen: Seit dem 31. Juli 2025 wurden von den USA rund 39 % auf einen Grossteil der Schweizer Importe erhoben. Es handelte sich dabei um einen neuen länderspezifischen Zollsatz, der nur für die Schweiz gültig ist. Für andere Länder gelten andere Zollsätze. Die Schweizer Regierung versuchte seither mit den USA zu verhandeln und hat sich im November im Rahmen einer Absichtserklärung geeinigt. Nach dieser soll die USA, im Gegenzug zu wirtschaftlichen Zugeständnissen der Schweiz, den Zoll auf 15% senken.
Was das langfristig für uns bedeutet, kann nur spekuliert werden. Allerdings ist, wie oben erwähnt, der Export zentral für die Schweizer Wirtschaft. Dabei exportieren wir in die USA am meisten: Fast ein Fünftel aller Waren und Dienstleistungen, die wir ins Ausland verkaufen, gehen in die USA (Stand 2024 – Quelle).
Errhebt Trump die Zölle, zeigt sich das auch konkret in unserem Alltag:
- Insbesondere in Branchen, die auf den Export in die USA angewiesen sind, könnten Arbeitsplätze verloren gehen.
- Durch das strauchelnde Wirtschaftswachstum werden weniger neue Arbeitsplätze geschaffen.
- Produkte werden teurer. Insbesondere in den Importländern ist mit einer Preissteigerung zu rechnen und kann damit einkommensschwache Personen empfindlich treffen.
- Die Beziehung zu den USA könnte stark strapaziert werden und damit andere Bereiche der Zusammenarbeit negativ beeinflussen. Konkret bedeutet das, dass Abkommen in unterschiedlichsten Bereichen – von der Sicherheit über den Klimaschutz bis hin zum Schüleraustausch – infrage gestellt oder ausgesetzt werden können.