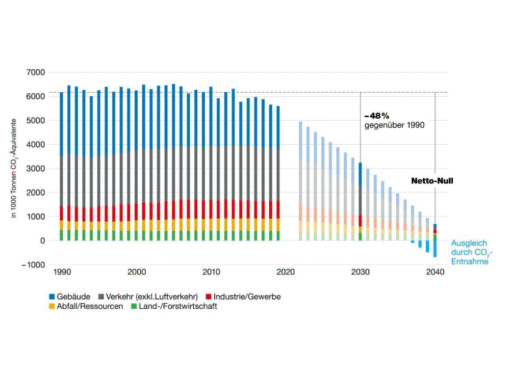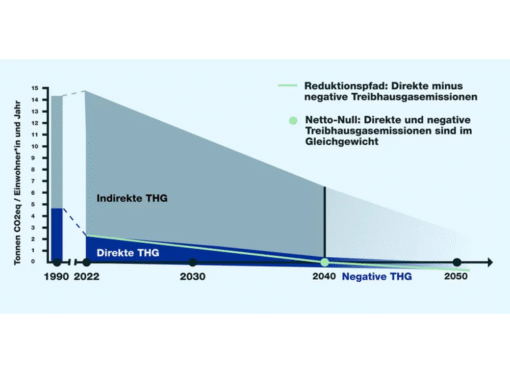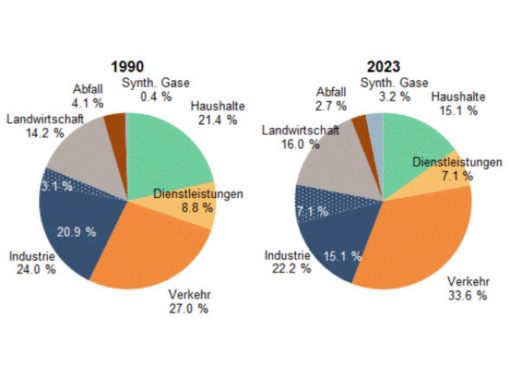Die Zürcher Stimmbürger:innen haben sich in klimapolitischen Vorlagen mehrheitlich zustimmungsfreudig gezeigt:
1) Die Vorlage, die im kantonalen Energiegesetz klimaneutrale Heizungen vorschreibt, wurde im November 2021 mit 62,6 Prozent Ja-Stimmen angenommen (Quelle)
2) Der Klimaschutzartikel in der Kantonsverfassung, der Netto-Null verbindlich verankert, fand im Mai 2022 mit 67 Prozent breite Zustimmung (Quelle)
3) Das Bundesweite Klimaschutzgesetz vom Juni 2023 wurde in Zürich mit rund 62,5 Prozent Ja-Stimmen angenommen (Quelle)
4) Selbst das CO2-Gesetz, was auf Bundesebene abgelehnt wurde, wurde in Zürich mit 55,4 Prozent Ja-Stimmen knapp angenommen (Quelle)
Die Abstimmung fügt sich also in eine Reihe früherer Entscheide ein, wo die Zürcher Bevölkerung Klimamassnahmen unterstützt hat.